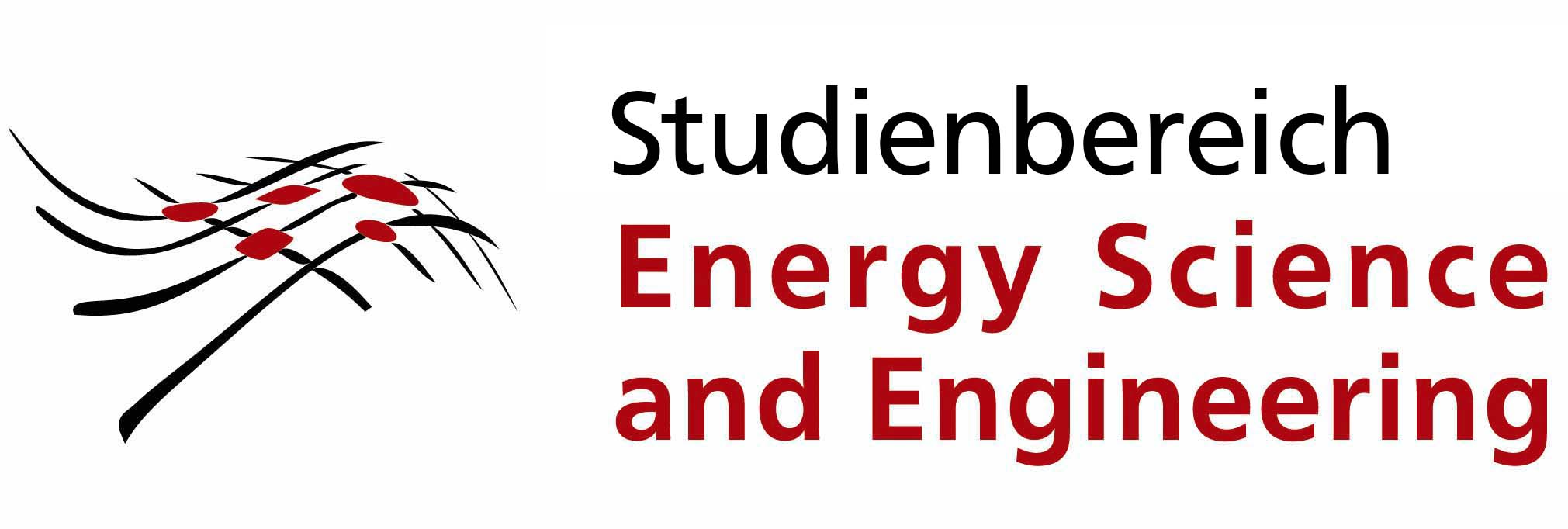Navigieren durch die Energiewende
Interview mit Prof. Michèle Knodt
29.06.2020 von Jutta Witte
Wie kann die Politik die Energiewende besser koordinieren und die Menschen intensiver einbeziehen? Michèle Knodt, Professorin für Politikwissenschaft an der TU Darmstadt und Co-Sprecherin des Profilbereichs, analysiert Problemfelder und gibt konkrete Empfehlungen.

Frau Professorin Knodt, Sie erforschen die politische Umsetzung der Energiewende und haben zuletzt das Kopernikus-Projekt ENavi mitgesteuert. Warum brauchen wir ein Navigationsgerät für die Transformation?
Weil es mit dem Transformationsprozess an vielen Stellen hakt. Weniger beim Ausbau der Erneuerbaren Energien. Da stehen wir relativ gut da. Was nicht funktioniert, sind die Einsparungen bei den C02-Emissionen, vor allem in den Bereichen Energie, Wohnen und Verkehr. Beim Thema Effizienz hinken wir ebenfalls hinterher.
Woran liegt das nach Ihrer Einschätzung?
Die Energietransformation ist ein Querschnittsthema, das ganz viele Bereiche vom Strom über Mobilität bis hin zum Wohnen berührt. Um das zu managen, muss die Politik in zwei Dimensionen agieren, also auf der horizontalen Ebene eine Vielzahl an Ministerien koordinieren und vertikal betrachtet die verschiedenen Gestaltungs- und Entscheidungsebenen einbinden – von der EU bis zu den Bundesländern. Und da sehen wir Schwachstellen.
Wie sieht die Situation in Deutschland aus?
In Deutschland sind inklusive des Kanzleramts sechs Ressorts beteiligt. Die Führung für Energie liegt beim Bundeswirtschaftsministerium und für Klima beim Umweltministerium. Allein im BMWI befassen sich 34 Referate in vier Abteilungen mit dem Thema. Wenn man das hochrechnet, kann man sich vorstellen, wie viele Menschen Sie zusammenbringen müssen. Deutschland verfolgt dabei das Prinzip der negativen Koordination. Dies bedeutet: Einer hat die Federführung und legt einen Vorschlag vor, der dann die Runde durch die Ressorts macht. Die haben eigene Ressourcen, wollen ihre Zuständigkeiten verteidigen und werden außerdem unterschiedlich parteipolitisch geführt. Beim Ringen um den 2016 vorgelegten Klimaplan konnte man gut sehen, wohin diese Mischung aus Ressort-Partikularismus und Parteipolitik führt. Nämlich zum kleinsten gemeinsamen Nenner.
Was wäre Ihr Vorschlag?
Wir empfehlen den Weg der positiven Koordination, zum Beispiel mit einer interministeriellen Gruppe, die auf fachlich-inhaltlich-technischer Ebene angesiedelt ist. Ein Gremium, das gemeinsame Perspektiven entwickelt und dann einen Vorschlag erarbeitet, mit dem sich alle über die Ressort- und Parteigrenzen hinweg identifizieren können. Das führt meistens zu qualitativ besseren Ergebnissen. Je länger solche Gremien zusammenarbeiten, desto größer wird ihr Korpsgeist. In der EU konnte man diesen positiven Effekt zum Beispiel bei der langjährigen Zusammenarbeit der Core Executives im Finanzbereich beobachten.
Immerhin gibt es in Deutschland seit 2019 ein Klimakabinett, bei dem alle Zuständigen an einem Tisch sitzen. Ist das nicht ein Schritt in die richtige Richtung?
Im Prinzip schon. Aber schon am Namen merkt man, dass das Ganze falsch aufgehängt ist. Da sitzen die Hausspitzen zusammen und verhandeln über die Vorlage eines Ministeriums, vor allem aber über das, was gerade politisch hoch umstritten ist. Das kann nicht funktionieren, weil es vor allem politisch und ideologisch getrieben ist. Man sieht ja: Die Menschen sind unzufrieden mit den Ergebnissen. Die Resonanz auf die Regelungen zur CO2-Abgabe war verheerend. Wir würden dafür plädieren, den Gestaltungsprozess viel niedriger anzusetzen und eine kontinuierliche interministerielle Zusammenarbeit auf der Fachebene zu installieren. Es geht darum, etwas gemeinsam zu erarbeiten.
Schauen wir in Richtung EU. Die Energieunion soll dafür sorgen, dass die Energie- und Klimaziele verfolgt und umgesetzt werden, aber ihr fehlen hierfür offenbar die richtigen Instrumente.
Die EU steht vor einem Dilemma. Einerseits soll sie sich darum kümmern, dass Energie sicher, nachhaltig und wettbewerbsfähig wird. Andererseits darf sie sich nicht in die Energiepolitik der Mitgliedstaaten einmischen. Sie hat null Eingriffsmöglichkeiten. Die Energieunion ist 2014 also unter denkbar schlechten Voraussetzungen gestartet: ohne Sanktionsrechte, ohne Selbstverpflichtungen der Mitgliedstaaten, aber belastet durch Konflikte zwischen Ost und West. Hieran hat auch die Governance-Verordnung von 2018 wenig geändert.
Warum?
Weil sie nach wie vor nur eine weiche Steuerung ermöglicht. Ohne Hierarchien und Kompetenzen kann die EU nur Leitlinien vorlegen, sich die Umsetzung zeigen lassen, sie bewerten und Verbesserungsvorschläge machen. Dem sollen und können die Mitgliedstaaten folgen, müssen sie aber nicht.
Wie kann man der Energieunion zu mehr Durchsetzungskraft verhelfen?
Man müsste die Energiepolitik an ein Politikfeld koppeln, das harte Steuerungsmöglichkeiten hat: die Strukturfondspolitik. Sie wurde zwar ursprünglich zur Förderung schwächerer EU-Regionen initiiert, aber heute profitieren alle Mitgliedstaaten von diesen Fonds. Energietransformation und Klimawandel sind bereits inhaltliche Schwerpunkte, die hierüber gefördert werden. Dies müsste man weiter ausbauen und stärker mit den Bestimmungen der Governance-Verordnung verzahnen. So wären nicht nur stärkere inhaltliche Vorgaben und Akzente möglich. Man könnte vor allem auch die Vergabe und Auszahlung von Fördergeldern an die Umsetzung bestimmter Maßnahmen koppeln.
Großen Handlungsbedarf sehen Sie auch beim Thema Bürgerbeteiligung. Wie kann man die Menschen besser in die Transformation einbinden?
Im Moment beobachten wir in Deutschland ein Paradox: Alle sind für die Energiewende, aber wenn es an die Umsetzung geht, sehen viele Menschen das plötzlich anders, zum Beispiel, wenn das Windrad vor der eigenen Tür gebaut werden soll. Das liegt daran, dass die Bürger insgesamt zu spät beteiligt werden. Erst im Raumordnungsverfahren gibt es fest verankerte Partizipationsmöglichkeiten. An der weit davor liegenden Wertediskussion zu den übergeordneten Zielen der Energiewende und akzeptablen Zumutungen, also der Erarbeitung der großen Kriterien sind die Bürger nicht beteiligt. Wir brauchen aber Partizipation von Anfang an auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene. Und der Konsens, der auf diesen Ebenen erzielt wird, muss Eingang finden in das repräsentative System. So werden frühzeitig die roten Linien klar und so kann man letztlich auch die Akzeptanz für die Energietransformation erhöhen.